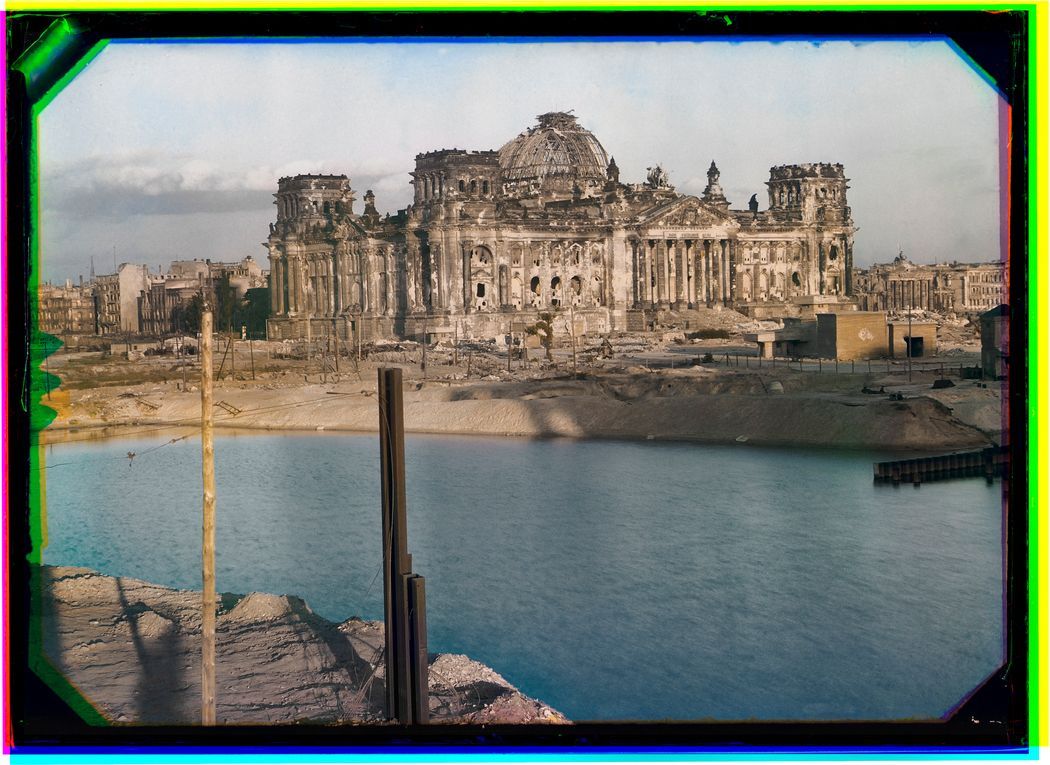Hendrik Bicknäse: „Wenn es eine deutsche Kultur nicht gäbe, erübrigten sich auch alle Bestrebungen, sie zu erhalten.“
Am 3. Oktober 2025 feiern wir 35 Jahre Deutsche Einheit – ein Tag, an dem unsere Brüder und Schwestern wiedervereinigt wurden, aber auch ein Moment, der Spaltungen in unserer Gesellschaft sichtbar macht. Deshalb haben wir mit Hendrik Bicknäse gesprochen, einem Zeitzeugen der deutschen Teilung und Wiedervereinigung, dessen Buch "Deutscharbeit - Mein Leben als Sohn" persönliche und gesellschaftliche Brüche reflektiert. Als Schriftsteller, Journalist und Kunstvermittler hatte Bicknäse, geboren 1947 in Nienburg/Weser, einen einzigartigen Blick auf die Nachkriegszeit, die DDR-Grenze und die Ostpolitik. Seine Erfahrungen – von der U-Haft 1966 wegen eines Ostkontakts bis zur Mitgründung der Gesellschaft für Kulturaustausch e.V. 1985 – machen ihn zu einer authentischen Stimme für die Herausforderungen der Einheit. Sein Buch hat historische Tiefe und behandelt aktuelle Fragen zu Meinungsfreiheit und zur kulturellen Identität. Seine Arbeit in der anti-autoritären Bewegung der 1960er/70er, seine Rolle bei der Frankfurter Gegenbuchmesse 1977/78 und sein Engagement für Kunst ohne Grenzen spiegeln einen lebenslangen Einsatz für Dialog und Völkerverständigung wider. Sein kritischer, nuancierter Ansatz regt an, über Demokratie und Zusammenhalt nachzudenken.
————-
3. Oktober 2025
Continue reading in English
IN FOCUS/BOOKS
Name: Hendrik Bicknäse Autor "Deutscharbeit - Mein Leben als Sohn"
„Lasst uns teilnehmen an den Aufgaben der Gegenwart. Und das können wir nur
mit Leitlinien, die unsere eigene Zeit übersteigen, um zu wissen, wer wir sein wollen."
Alethea Talks: Herr Bicknäse, der 3. Okt. 2025 markiert 35 Jahre deutsche Einheit – ein Meilenstein, der Einheit feiert, aber auch Spaltungen sichtbar macht. Als jemand, der die Teilung Deutschlands miterlebt hat, wie reflektieren Sie heute über die Bedeutung dieses Tages, sowohl persönlich als auch für die Gesellschaft?
Nur noch 40 Prozent der Deutschen glauben laut einer neuen Umfrage, ihre Meinung frei äußern zu können. Das müsste in einer Demokratie den Medien Anlass geben für eine Sondersendung nach der anderen. Stattdessen diskutiert Deutschland in den Medien Abend für Abend über die vermeintliche oder tatsächliche Gefahr, die von der AfD ausgeht. Übersehen wird dabei die autoritäre Gefahr, die vom „Kampf gegen rechts“ ausgeht.
Deutschland hat beim Kampf gegen den global im Aufwind begriffenen Rechtspopulismus einen autoritären Sonderweg eingeschlagen. Die Amerikaner haben das nur früher als viele andere erkannt. Wer meint, dass solche Kritik nur aus dem Trump- Lager kommt, sollte genau hinsehen: Zum Beispiel bei der Late-Night-Show von Bill Maher. Der Komiker ist beileibe kein Sprachrohr der Republikaner, er setzt sich parteipolitisch regelmäßig zwischen alle Stühle. Er spricht über die große Bedeutung der Meinungsfreiheit auf der Welt. Um zu belegen, wie stark sie in Gefahr sei, führte er mehrere Beispiele an. Eines davon stammt aus Deutschland, dem Land, in dem nichts einmal klassische Liberale noch begreifen, was hierzulande beim grenzenlosen Kampf gegen „Hass und Hetze“ geschieht.
Bei Gesprächen mit meinen Verwandten in Mecklenburg erlebe ich das Unverständnis, mit dem diese im Kulturkampf eine verlogene Diskussion gegenüber der AfD erkennen. Als ob die AfD aus dem Nichts käme. Im Endeffekt ist sie ein Symptom. Ich halte es für zutiefst undemokratisch, Menschen, die die AfD wählen, weil sie sich nicht mehr durch die etablierten Parteien verstanden fühlen, als Nazis oder rechtsradikal zu diffamieren. Man tut diese Menschen, und das sind derzeit immerhin 26 Prozent der Wähler, als per se unmoralisch ab. Ich halte das für eine überaus gefährliche Haltung und Entwicklung. In den meisten angrenzenden Staaten gibt es ähnliche Tendenzen, was den Rechtsruck der Parteienlandschaft angeht. Jedoch gibt es keinen Staat, in welchem die Ausgrenzung geradezu als Einladung für die Entwicklung einer gedemütigten Partei wirkt, in welcher diese in ihrer Isoliertheit erst richtig aufblüht und sich als Alternative mit Märtyrer-Glanz schmückend umgibt. Im Gegenteil: In Koalitionen oder Absprachen werden in nordischen Nachbarländern rechte Parteien in die Verantwortung gezogen und ihr Wachstum wird sehr konkret begrenzt. Man redet und arbeitet miteinander! Meiner Ansicht nach waren wir einer deutschen Einheit schon mal nähergekommen, haben leider Kurs und Orientierung an Kräfte abgegeben, die als Gleichheitsfanatiker den Sozialneid kultivieren.
Als Schriftsteller und Journalist haben Sie die Nachkriegszeit und die Wiedervereinigung aus einer kritischen Perspektive erlebt. Was waren Ihre sorgenvollsten, aber auch die schönsten Erinnerungen?
Die für mich schwerwiegendste frühe Erfahrung war meine Verhaftung aufgrund eines Ostkontaktes an der Grenze zur damaligen DDR. In der Konsequenz wurde ich dafür 1966 in der Bundesrepublik als heranwachsender junger Mensch über längere Zeit - dreieinhalb Monate - in U-Haft gehalten, obschon ich nie etwas Verräterisches getan hatte und mir solches auch nicht vorgeworfen wurde. Allein die Tatsache eines Ostkontakts reichte damals bis 1968 aus, um „landesverräterische Beziehungen“ strafrechtlich zu verfolgen. Bald nachdem mein Urteil unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit 28 Tagen Jugendarrest 1967 verkündet worden war - wobei die erlittene Untersuchungshaft nicht angerechnet wurde! -, trat das erwartete Straffreiheitsgesetz 1968 in Kraft, welches den unseligen Paragraphen der „landesverräterischen Beziehungen“ gänzlich eliminierte.
Die Vorbereitungen zur Straffreiheit waren durch den damaligen Bundesjustizminister Heinemann bereits im Gange, als das Urteil gegen mich verkündet wurde. Daran orientierten sich die älteren Richter am Oberlandesgericht jedoch nicht. Die neue Ostpolitik in der Regierung von Willy Brandt wurde vielmehr von älteren hohen Richtern abgelehnt; dieselben Oberlandesgerichtsräte, die bereits bis 1945 ihrem Staat überwiegend treu gedient hatten.
"Bis dahin waren Kontakte zu offiziellen Personen nach „drüben“ in die DDR nicht erlaubt."
Und dies ist meine schönste Erinnerung: Als Willy Brandt in neuer Position endlich Fahrt aufnahm. Der „Wandel durch Annäherung“, wie die damalige neue Ostpolitik hieß, tauchte gerade erst als zarte politische Morgenröte am Horizont auf. Bis dahin waren Kontakte zu offiziellen Personen nach „drüben“ in die DDR nicht erlaubt. Mit seiner Politik sorgte er damals in Deutschland für einen Aufbruch der Verkrustung und gab seiner neuen Politik auch juristisch Geltung.
Die Justizopfer des Kalten Krieges werden im Westen leider weiterhin verschwiegen - ja, sie sind nahezu vergessen. Die damaligen Urteile mit der Tendenz zur Geheimjustiz sind bis heute ein verdrängtes Tabu-Thema geblieben. Eine Aufarbeitung hat zu keiner Zeit stattgefunden. Die Justiz im „Unrechtsstaat DDR“ dagegen wird aus Sicht der alten Bundesrepublik seit der Wiedervereinigung 1990 immer wieder und im Brustton größter moralischer Überlegenheit vollmundig skandalisiert. Die öffentlich-rechtlichen Medien nehmen ihre Aufgabe hier nicht wirklich war. Es sollte sich nun niemand darüber wundern, dass das Zusammenwachsen zwischen Ost und West weiterhin zäh bleibt und nur zögerlich und widerständig vonstatten geht.
„Ich frage mich manchmal, was wäre aus der DDR geworden, wenn sich die Befreiung aus moskautreuer Prägung hin zu einem eigenen, zweiten deutschen Staat selbständig entwickelt hätte?“
Der 3. Oktober symbolisiert „Wandel durch Annäherung“, ein Konzept, das in Ihrer Generation diskutiert wurde. Wie sehen Sie diesen Ansatz heute, in einer Zeit, in der globale Konflikte und nationale Identitäten in Frage stehen?
Die deutsche Wiedervereinigung hatte ich zunächst mit großer Freude, ja, mit Erleichterung wahrgenommen. Meinen Wohnsitz habe ich in den frühen 90er Jahren in eine kleine Stadt südlich von Berlin nach Brandenburg verlegt, unweit der polnischen Grenze. Denn meine Frau hatte damals eine polnische GmbH gegründet, in der im polnischen Niederschlesien Bauchemie produziert wurde. Wie unterschiedlich die Vorstellungen der Menschen in den östlichen Bundesländern sind, wo Fremdes erstmal abgelehnt wird, erfuhr ich dort rasch, wenn ich zum Beispiel mit meinen polnischen Freunden eine Gaststube betrat: es schlug uns eisiges Schweigen beredt entgegen. Der Westdeutsche an sich war schon ein Fremder, dem man mit Misstrauen begegnete. Ein Fremder, der nicht deutsch sprach, blieb doppelt fremd. Ich frage mich manchmal, was wäre aus der DDR geworden, wenn sich die Befreiung aus moskautreuer Prägung hin zu einem eigenen, zweiten deutschen Staat selbständig entwickelt hätte? Ein solcher Demokratieversuch ist in Polen und in den kleinen baltischen Ländern sehr gut und viel besser als in Ostdeutschland gelungen. Da gab es nicht den großen Bruder, der alles besser weiß und drangsaliert, mit Geld und Wohltaten die Strukturen erst zerschlägt, um sie dann neu zu errichten. Dem man noch dankbar sein soll und der doch alles – vor allem die Erinnerung – zerstören will. Wie sonst ist der unproduktive Selbsthass so mancher Ostdeutschen zu erklären, mit dem die pekuniären Wohltaten angenommen werden?
Die Polen und alle anderen ehemaligen Ostblock-Staaten hatten nur die Unterstützung der Europäischen Gemeinschaft, aber keinen zusätzlichen Besserwisser, der ihnen vorschreibet, was zu tun ist, und niemandem mussten sie dankbar sein, da sie allein aus eigener Kraft mit aufgekrempelten Ärmeln die Aufgabe der Erneuerung annahmen und heute zu Recht stolz sein dürfen auf das von ihnen Erreichte. Als Europäer der ersten Stunde habe ich erlebt, wie glanzvoll sich gerade kleine europäische Staaten im Konzert der Europäischen Union behaupten und entwickeln können, und wie schwer es dagegen den größeren europäischen Staaten oft fällt, die auch noch Führung beweisen sollen, bei den Geschwindigkeiten und Fähigkeiten kleinerer Staaten mitzuhalten – wir brauchen nur an die Digitalisierung zu denken oder an die schwierige Anpassung unserer Gesellschaft an neue geopolitische Realitäten. Als größter Mitspieler in der Europäischen Union hat das wiedervereinte Deutschland eine schwierige Rolle übernommen: Es soll führen, aber so, dass es keiner merkt und niemandem wehtut; es soll wirtschaftliche Lokomotive bleiben, aber soll sich einer lockeren Finanzpolitik der südlichen Mitgliedsländer einschließlich Frankreich nicht verschließen, sogar anschließen; soll sich nicht aufspielen, denn ein bisschen Angst hat man doch vor einem Staat, welcher die anderen Mitglieder dominiert. Wäre es nicht für die beiden deutschen Staaten BRD und DDR viel einfacher und erfolgreicher, die zwei Staaten zu belassen und einander in dieser Form zu vertrauen und sich gegenseitig zu beflügeln und zu begegnen? Das europäische Projekt verlangt nicht nach Größe der Mitglieder, aber nach Teilnahme jedes einzelnen Bürgers.
„Die geopolitische Situation hat sich massiv verändert und wir wurden daran erinnert: Krieg, Eroberungen und Unterdrückung sind eine historische Konstante in allen Kulturen.“
Wie hat das Schreiben über Ihre Erlebnisse Ihnen geholfen, die Brüche der deutschen Geschichte zu verstehen, und was wünschen Sie sich für die Zukunft von Deutschland am 35. Jahrestag der Einheit?
Im Bonner Hofgarten skandierten wir im Oktober 1981 bei unserer großen Demonstration gegen atomare Aufrüstung mit „Frieden schaffen ohne Waffen!“ Dies war unser aller Credo bis in die neunziger Jahre. Dabei hielt nur die gegenseitige Bedrohung von Ost und West die Welt in relativer Friedensruhe und Balance. Allein diese Tatsache war lange Zeit die Friedens-Grundlage zwischen Ost und West. Bis zu 5 % des damaligen Bruttosozialprodukts wurde jahrzehntelang von der damaligen Bundesrepublik bis zum Ende der 80er Jahre für Sicherheit, Rüstung und Bundeswehr ausgegeben, und niemand fand etwas dabei. Im Gegenteil: So konnten wir bequeme Friedensapostel sein und längere Zeit galt dies in der Mehrheit der Bevölkerung als eine Politik der Weltverbesserung. Aber eben doch nur so lange wie die gegenseitige Balance erhalten blieb. Wie naiv kann man nur sein! Ich war gerne Fantast und habe Gedichte geschrieben für eine unbewaffnete Gesellschaft.
Zusammen mit den Vielen, die ebenso wie ich an einen ewigen Frieden glauben wollten, haben wir später, seit den späten Nuller Jahren, gegen jede Vernunft den Aufbau einer Verteidigung verhindert und immer lautstark gegen derartige Pläne protestiert. Das Thema muss neu bewertet werden. Die geopolitische Situation hat sich massiv verändert und wir wurden daran erinnert: Krieg, Eroberungen und Unterdrückung sind eine historische Konstante in allen Kulturen. Es lohnt sich, daran zu erinnern, worin der Sinn von Verteidigungsbereitschaft besteht. Sie soll Schaden abwenden. Sie ist kein Prinzip um seiner selbst willen, sie dient vielmehr einem Zweck. Ihre Richtschnur ist eine einzige Frage: Werden Land und Leben dadurch sicherer? Müsste die Frage verneint werden, wäre die Verteidigungsbereitschaft obsolet. Dass seit einigen Jahrzehnten die Reduzierung der Bundeswehr und der Abbau von Waffen inzwischen eine längere Tradition in Deutschland hatte, ist kein hinreichender Grund, daran festzuhalten. Ich wünsche mir zum 35. Jahrestag der deutschen Einheit ein Einsehen: Jetzt muss ein Mehrwert in Sachen Sicherheit geschaffen werden. Und nicht nur mit Geld. Es geht vielmehr darum, ein neues Bewusstsein für die Aufgaben der Gesellschaft zu schaffen.
„Als Patriot dieser Welt, will ich weiter auf Gefühl und Verstand vertrauen und auf mein Inneres hören.“
Wie ist Ihre Sicht auf die kulturelle Vielfalt Deutschlands heute, besonders im Kontext des 3. Oktobers?
Die Erinnerungsdebatte zur deutschen Wiedervereinigung verläuft eigentlich eher an der Oberfläche. Was sich wirklich bewegt, ist die Gesellschaft. Gerade die Nicht- oder Noch-nicht-Deutschen Bürger und Bewohner dieses Landes mit unterschiedlichen Religionen und Gebräuchen, Werten und Lebensvorstellungen wären dringend darauf angewiesen, zu wissen, was dies Land im Kern überhaupt zusammenhält, das zu ihrer neuen Heimat geworden ist. Zunehmend leidet das Land unter Zeitgeistdebatten, die das Dasein vergällen. Neben der deutschen Sprache als Heimat gibt es eine im Alltag unausgesprochene deutsche Kultur, die jeder wahrnimmt, der hier lebt, und jeder, der von außen kommt in einem Gefühl des Fremdseins empfindet. Natürlich ist sie nicht leicht zu benennen, aber sie zeigt sich etwa daran, wie man miteinander umgeht, debattiert und was man isst; an einer Geschichte, die man kollektiv „deutsche Geschichte“ nennt, in Konzepten von Nähe und Distanz, von Öffentlichkeit und Privatheit. Wenn es eine deutsche Kultur nicht gäbe, erübrigten sich auch alle Bestrebungen, sie zu erhalten.
Ja, es könnte so einfach sein. Wenn man nur wollte. Wenn man die eingeübten Reflexe, links wie rechts, endlich ablegen könnte. Wenn der allgegenwärtige strukturelle Moralismus nicht mehr als Ersatzreligion, als Lückenbüßer für Selbstbewusstsein und Staatsräson gebraucht würde, obwohl er mit nationalistischem Größenwahn mehr gemeinsam hat, als einem lieb sein kann. Es wird dauern, und wer weiß, vielleicht werden am Ende die Zugewanderten, unter denen gewiss viele „neue Deutsche“ wären, die „alten Deutschen“ dazu zwingen, das gemeinsame Selbstbewusstsein einer modernen Nation zu entwickeln. Einfach deshalb, weil es anders nicht geht. Das wäre dann schon fast wieder ein historisch-dialektischer Vorgang. Als Patriot dieser Welt, will ich weiter auf Gefühl und Verstand vertrauen und auf mein Inneres hören.
„ Darum: Lasst uns teilnehmen an den Aufgaben der Gegenwart. Und das können wir nur mit Leitlinien, die unsere eigene Zeit übersteigen, um zu wissen, wer wir sein wollen.“
Was möchten Sie der jungen Generation, die den 3. Oktober 2025 erlebt, mit Ihrem Buch mitgeben?
Mag sein, dass die größte Gefahr für Deutschland und das europäische Projekt gar nicht von außen kommt, sondern von uns und dem Westen selbst ausgeht. Von seiner Fähigkeit zur Selbstkritik, die seine größte Stärke ist, aber zur Schwäche werden kann, wenn sie ausgenützt wird. Von einer Linken, die, angestachelt von der postkolonialen Kritik das westliche Erbe pauschal unter Verdacht stellt. Von einer Rechten, die universalistische Prinzipien ablehnt und die Demokratie schlechtredet. Und von einer Gesellschaft, die den Wert der Freiheit nicht mehr schätzt und nicht mehr schützt, weil sie sie für selbstverständlich hält. Darum: Lasst uns teilnehmen an den Aufgaben der Gegenwart. Und das können wir nur mit Leitlinien, die unsere eigene Zeit übersteigen, um zu wissen, wer wir sein wollen.
---------
TOP STORIES
DÜSSELDORF
Dr Bastian Fleermann: ‘From the first to the very last day in Düsseldorf, there was resistance from very courageous men and women, from very different directions.’
_____________
ENVIRONMENT
007: Who is Paul Watson and why was he arrested?
_____________
FREEDOM OF SPEACH
Julian Assange und die Pressefreiheit. Eine kleine Chronik (DE)
_____________
DÜSSELDORF OPERA
The surprising switch of course
_____________
PHOTOGRAPHY
Without censorship: World Press Photo publishes the regional winners of the 2024 photo competition
_____________
FLORENCE
_____________
April 2024
DÜSSELDORF
Controversy surrounding the Düsseldorf Photo Biennale
_____________
WAR
March 2024
_____________
ISRAEL
November 2023
_____________
ENGLISH CHRISTMAS
10 years of Glow Wild at Kew Wakehurst.
October 2023
_____________
TRIENNALE MILANO
Pierpaolo Piccioli explains his fascination with art.
_____________
NEW MUSEUMS
29 May 2023
_____________
NEW MUSEUMS
is coming in big steps.The Bernd and Hilla Becher Prize will be awarded for the first time.
19 May, 2023
_____________
VISIONS, ARCHITECTURE
MARCH 10, 2023
_____________
CHECK THE THINGS YOU WANT TO THROW AWAY
HA Schult's Trash People at the Circular Valley Forum in Wuppertal on 18 November 2022.
NOVEMBER 19, 2022
_____________
THE OPERA OF THE FUTURE
Düsseldorf, capital of North Rhine-Westphalia will receive the opera house of the future.
FEBRUARY 15, 2023
_____________
FLORENCE
The extraordinary museums of Florence in 2023.
JANUARY 1, 2023
_____________
DÜSSELDORF
DECEMBER 11, 2022
RELATED TALKS